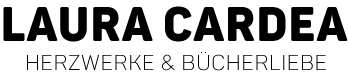Superior Lies. Falsche Wahrheit
Wenn alle besonders sind – nur du nicht.

Absolute Gerechtigkeit
Jeder ist gleich wichtig. Jeder gleich viel wert. Egal welche Fähigkeiten oder Talente du hast, dein Platz im Kollektiv ist sicher. Keine Arbeitslosigkeit, keine Obdachlosen, minimale Verbrechensrate - das klingt perfekt, oder?

Junge Journalistin
Margo brennt für ihren Beruf als Journalistin, denn filmen ist das, was sie schon immer machen wollte. Doch sie blickt immer weiter hinter die Kulissen des Kollektivs. Und was sie erfährt, ist weit von Perfektion entfernt.

Geheime Rebellion
Die Mitglieder des Kollektivs wagen nicht einmal hinter vorgehaltener Hand, die Terroristen zu erwähnen. Doch Margo macht auf der Suche nach ihrer Freundin Melek Bekanntschaft mit den Rebellen, die sie eigentlich verabscheut.
Prolog
Er hält sie mir vor die Nase, milchig-weiße Handschuhe, die töten können. Handschuhe, die mich zu dem machen, was ich eigentlich sein soll.
»Zieh sie an«, befiehlt Vater, während er mir schon selbst die Handschuhe überstülpt. Als würden meine Hände in den Fruchtpudding getaucht, den es nur am Dankbarkeitsfest gibt. »Und Margo, vergiss nicht, dass du dich auf keinen Fall selbst berühren darfst!« Seine Stimme, sonst immer so ruhig und sanft, lässt mich zusammenzucken. Er hat es mir unzählige Male eingebläut, sodass mir mittlerweile klar ist, welche Gefahr von seiner Erfindung ausgeht. Doch nur die vorgegaukelte Fähigkeit durch diese Handschuhe schützt mich davor, von meinen Eltern weggerissen zu werden, weil ich keine Superior bin.
»Können wir wieder nach Hause, Papa?«, frage ich, während das Material der Handschuhe mit meinen Unterarmen verschmilzt, das milchige Latex sich in das nur wenig dunklere Weiß meiner Haut verfärbt. Vater dreht meine Arme in alle Richtungen, fast so grob, dass es schmerzt, um von jeder Seite nach eventuell sichtbaren Fehlern zu suchen. Doch seine Erfindung ist perfekt.
»Gaspard«, zischt meine Mutter, die am Türspalt der Toilette Wache steht. »Beeil dich, die Inspekteurin wartet.«
Vater zieht die Ärmel meines Kleides über meine Unterarme. Dieses Kleid hing unberührt im Schrank, seit es mir zur Verfügung gestellt wurde. Es hat keine Falten, keine leicht ausgefransten Nähte, keine hauchfeinen Überreste von Flecken wie der Rest meiner Kleidung. Meine Eltern wollen für den bestmöglichen Eindruck sorgen, denn die Bewertung heute bestimmt über mein Schicksal.
Vater schiebt mich durch die Tür der Toilettenkabine hinaus, darauf bedacht, meine Hände nicht zu berühren. Ich will die Hand meiner Mutter ergreifen, so wie ich es an jedem anderen Tag tun würde. Der Wunsch wird dringlicher, sobald wir durch die Tür der Gästetoilette hinaus auf den Flur treten und sich die Oberinspekteurin vor uns aufbaut. Eine gesetzte Frau, scheinbar nur Kanten und Linien, von den polierten Lackschuhen bis zu jedem einzelnen, akkurat gekämmten Haar ihres Dutts. Meine Hände bleiben an meinen Seiten hängen.
»Hart mein Name. Sie sind spät. Hätten Sie Ihr Kind nicht zu Hause auf die Toilette schicken können?« Der Ton ihrer Stimme ist ebenso geradlinig wie sie selbst. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, stöckelt sie in Richtung des Examinationsraums davon. Ihre breiten Absätze klackern und schmatzen abwechselnd auf den frisch gewischten Linoleumplatten.
»Mama«, wimmere ich, doch sie schiebt mich hinter der Inspekteurin her. Ich folge der Frau mit gesenktem Kopf, meine Augen auf ihre grauen Nylonstrümpfe gerichtet und die Hände viel zu steif in den Rockfalten neben meinem Körper versteckt. Ich presse mich durch den Spalt der Glastür, durch die sie verschwindet. Nach ein paar Schritten stehe ich in einem gläsernen Raum vor ihr und drei weiteren Inspekteuren, die mich freundlich anlächeln und mir gleichzeitig panische Angst bereiten. Was passiert, wenn sie merken, dass ich nicht zu ihnen gehöre?
Während sie sich zu den anderen Inspekteuren setzt, sehe ich mich um. Vor meinen Augen verschwimmt die riesige Hornbrille einer Person mit den gelben Vorderzähnen im strahlenden Lächeln einer anderen. In einer Ecke kauert ein drahtiger Mann mit fahler Haut. Er umklammert seine ausgemergelten Ellbogen. Ich wende den Blick hastig von ihm ab.
»Margo Bonnet, sechs Jahre. Superior. Schmerzauslösen durch Berührung mit den Händen. Ist das soweit korrekt?«, piepst eine Frauenstimme, bevor ich mich nur annähernd an den Raum, das grelle Licht und die fremden Menschen gewöhnen kann.
Meine Eltern beobachten mich durch die Glasscheibe, doch ich traue mich nicht, mich umzuschauen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich muss jetzt sprechen. Darf keine Angst zeigen. »Ja«, presse ich mit zittriger Stimme hervor, obwohl ich einen besseren Eindruck machen würde, wenn ich mehrere Worte sinnvoll aneinanderreihen könnte.
»Bitte präsentiere uns deine Fähigkeit.« Der Mann mit der zu großen Brille deutet auf den Mann in der Ecke. Auf seiner fahlen Haut schimmert ein dünner Film aus Schweiß und ein roter, wunder Ausschlag, der von seinem Hemdkragen bis zu seiner Wange kriecht, verrät, was er ist.
Ein Inferior.
Der Erste, den ich in meinem Leben sehe. Ich kann mich nicht rühren.
»Los, Mädchen«, befiehlt Inspekteurin Hart, doch meine Hand hebt sich immer noch nicht. Sie schnalzt mit der Zunge. »Die Inferior melden sich freiwillig für die Registrierung. Sie wissen, worauf sie sich einlassen.« Ich weiß, dass die Obrigkeit niemanden zwingt, als Testobjekt die Kräfte der Superior zu ertragen. Dennoch dröhnt ein Fiepen in meinen Ohren. Ich will ihn nicht berühren.
Der Inferior tritt an mich heran und das Kunstlicht flackert über seine zitternden Arme, huscht über angespannte Sehnen und Muskeln in jedem Körperteil. »Hab keine Angst.« Er ringt sich ein Lächeln ab. »Meine Zeit ist bald gekommen. Das hier ist meine letzte gute Tat für das Kollektiv.«
Ich strecke meine Hand aus, zaghaft. Mir ist, als triefe Eiter aus jeder seiner Poren, so sehr widerstrebt mir die Berührung. Ich halte die Luft an, will weglaufen vor ihm. Vor der Strahlenkrankheit. Ich hätte nichts zu befürchten, wenn ich wirklich eine Superior wäre. Doch niemand weiß, ob das mir fehlende Superior-Gen gegen die Krankheit immun macht oder sie einfach nicht ansteckend ist. Ich kann jetzt nicht darüber nachdenken, sondern muss mich auf die mikroskopisch dünne Schicht Latex über meinen Fingern verlassen. Ich kenne das Protokoll und weiß, was ich tun muss.
Meine Hand klammert sich um sein Handgelenk und augenblicklich bricht der Inferior mit einem unmenschlichen Schmerzensschrei in sich zusammen. Seine Stimme verzerrt sich von einem tiefen Grollen zu einem animalischen Kreischen und wieder zurück.
»Registriert als Superior«, bemerkt die Inspekteurin stolz, doch ihre Stimme ist nur ein gedämpftes Rauschen in meinen Ohren, die von den Schmerzensschreien des Mannes erfüllt sind. Meine Handfläche wird warm und seine Haut verbrennt, wirft unter meinem Griff Blasen, während er kreischt und stöhnt und weint, sich auf dem Boden windet wie ein Wurm.
Ich wünsche mir, ich wäre an seiner Stelle.
Kapitel 1
Ein heftiger Ruck des Zuges reißt mich aus meinem Traum, aus meiner Erinnerung. Mein Herz hämmert in meinem Brustkorb und in der ersten, schreckerfüllten Sekunde nach dem Aufwachen bin ich mir sicher, der alte Wagon entgleist. Doch ein paar tiefe Atemzüge später wird mir klar, dass er weiter über die Schienen gleitet, nur ab und zu durch das schrille Quietschen von Metall auf Metall unterbrochen.
Wieder dieser Traum. Meine Registrierung verfolgt mich nach vierzehn Jahren immer noch. Obwohl meine Erinnerungen schwammig sind und mein Gehirn einige Details hinzudichtet oder weglässt, im Traum scheint alles so echt. Nur verläuft der Traum jedes Mal etwas anders. Manchmal träume ich, dass ich fliehe, bevor sie mich untersuchen können. Manchmal träume ich, der Inferior stirbt unter meinem Griff. Die heutige Variante ähnelt den Erzählungen meiner Eltern am meisten. Laut ihnen habe ich geweint, aber das erlaubt mein Unterbewusstsein meinem Traum-Ich nie.
Ein erneuter Ruck schleudert mich aus dem Sitz. Je weiter wir uns von den sicheren Mauern des Gewölbes, der letzten Stadt der Welt, entfernen, desto öfter werde ich von Erschütterungen aufgeschreckt. Im Gewölbe brauchen wir keine Züge oder Autos, weil wir alle Strecken durch die kreisrunde Planstadt zu Fuß bewältigen können. So verschwenden wir keine Ressourcen. Meine Panik wegen der rasanten Fahrt ist also verständlich, sogar angebracht, denn Furcht schützt uns vor Gefahren – und was ist gefährlicher, als in dieser metallenen Todesmaschine gefangen zu sein? Dennoch muss ich mich beruhigen. Heute wird absolute Professionalität von mir erwartet.
Also atme ich tief durch und durchquere das Zugabteil mit zwei Schritten. Ich seufze dem Mädchen im winzigen Spiegel über dem noch winzigeren Waschbecken entgegen. Manchmal bin ich mir sicher, die anderen können mit einem Blick erkennen, dass ich nicht wie sie bin. Durch die violetten Augenringe vielleicht, welche sich bei der kleinsten Ermüdung unter meiner blassen Haut bilden. Oder weil ich nicht so athletisch wie die anderen Mädchen bin. Trainiert durch all den Sport, aber vor allem dank ihrer fantastischen, gesunden Superior-Gene.
Gene, die mir fehlen. Immerhin fehlt mir ebenfalls der Gendefekt, der die Inferior krank macht. Und meine vorgetäuschte Kraft genügt als Beweis dafür, dass ich zu den Superior gehöre. Die Warnzeichen, meine unnatürlich blasse Haut oder meine Statur, rund, weich und weiblich, ignorieren sie. Aber aus mir spricht nur die jahrelang eingebläute Angst. Tatsächlich sehe ich durchschnittlich aus, mit einem Gesicht, in dem alles in der richtigen Größe an der richtigen Stelle sitzt. Was gut ist. Unauffällig, ein wenig langweilig, aber das ist perfekt. Perfekt in einer Welt, in der wir alle gleich sind. Nur manchmal, wenn ich meine glanzlosen, grauen Augen studiere oder die schwachen Kurven meiner Durchschnittslippen, wünscht sich etwas in mir, anders sein zu können. Besonders. Ich schiebe diese Gedanken sofort beiseite, bevor sie meinen Geist vergiften. Das Kollektiv kann nur in seiner Gemeinschaft bestehen, ohne dass jemand herausragt. Ich muss nichts Besonderes sein, um zu etwas Besonderem beizutragen.
Also zerre ich resolut das Haarband aus meinem Dutt, der sich beim Schlafen gelöst hat, und wickle meine Haare mit einem wehmütigen Blick zurück in ihren perfekt gelegten Knoten. Die sanften Wellen sind das einzig Ungewöhnliche an mir. Ich mag sie, auch wenn ich es nicht sollte. Wieder ein gefährliches Gefühl in mir, das ich mit dem straffen Haarband abbinde und festzurre. Ein letzter Blick in den Spiegel. Perfekt, auch wenn mein Spiegelbild mich an die Oberinspekteurin meiner Registrierung erinnert. Aber auch das ist gut.
***
Mit unsicheren Schritten stakse ich zum Gemeinschaftsabteil, immer darauf bedacht, mich nicht vom ungewohnten Wanken des Fahrzeuges ins Stolpern bringen zu lassen. Dort vermute ich meinen Vorgesetzten Herrn Dvorak, den Intendanten der Redaktion, für die ich filmen werde. Ich fühle mich ganz und gar nicht bereit für meinen ersten Auftrag. Egal, wie stolz ich darauf bin, als neue Journalistin ausgewählt worden zu sein, jetzt wünsche ich mir, ich wäre im Keller einer Funkanstalt als Signalprüferin gelandet. Was auch immer ich in den nächsten Tagen produziere, jeder im Kollektiv wird es sehen. Außer es ist so schrecklich, dass Herr Dvorak mich direkt feuert und ich wirklich in besagtem Keller einer Funkanstalt lande. Als Putzkraft. Putzfrau zu sein ist nichts Schlimmes – im Gegenteil, wie jeder Beruf ist auch dieser von unfassbarem Wert für das Kollektiv. Nur träume ich seit Jahren von etwas anderem.
Ich zerre die Schiebetür zum Gemeinschaftsabteil auf, husche mit pochendem Herzen durch den winzigen Spalt zwischen beiden Wagons, in dem wilder Wind an meinem Haarknoten zerrt, und schließe mit einem tiefen Ausatmen die zweite Schiebetür hinter mir. Geschafft.
Prompt begrüßt Herr Dvorak mich mit einem kehligen Lachen. »Mädchen, Ihr Gesicht ist ja ganz grün. An die Zugfahrten werden Sie sich gewöhnen müssen.« Er patscht mit seiner tellergroßen Hand auf den Sofaplatz neben ihm. Mein Vorgesetzter nimmt genau zwei Plätze ein und wirkt durch seine Masse gemütlich, fast träge. Nicht wie jemand, der bereits um fünf Uhr morgens hellwach und korrekt gekleidet, rasiert und frisiert im Zugabteil arbeitet. Doch in den letzten Wochen konnte ich mir ein Bild davon machen, wie engagiert sich Herr Dvorak für die Redaktion einsetzt. Der Erste im Büro und der Letzte, der es verlässt. Er mag aussehen wie ein Walross mit Perücke, aber schon nach kurzer Zeit begriff ich, dass ich es mit einem Haifisch zu tun habe. Ein gutmütiger Haifisch, aber dennoch.
Ich stolpere zum Sofa und lasse mich in das Polster plumpsen. Im Sitzen kann ich wenigstens nicht stürzen. »Das Zugfahren ist gar nicht so übel, aber …« Ich blicke ihn hilflos an.
»Es ist ungewohnt. Sie werden sich daran gewöhnen. Mir ging es genauso, als ich in der Redaktion angefangen habe.« Er nickt mit einem leichten Lächeln.
»Kommen wir pünktlich an?«, frage ich, um nicht das übliche unangenehme Schweigen entstehen zu lassen, wenn ich in Gesellschaft anderer bin.
Viel geschickter, als man ihm zutrauen würde, tippt er auf seinem Tablet herum. »Laut Lokführer verläuft die Fahrt nach Plan. Wir sollten in einer halben Stunde im Quartier ankommen.«
Das Inferior Quartier des Kollektivs – ein so umständlicher Name, dass wir ihn immer abkürzen – liegt einige Stunden außerhalb des Gewölbes. Im Quartier stellt die Obrigkeit Wohnungen und Arbeitsplätze für die Bewohner bereit, die an der Strahlenkrankheit leiden, um ihnen ein gerechtes und angenehmes Leben zu ermöglichen, das ihnen zwischen den Superior im Gewölbe nicht möglich wäre.
Ich war nie dort. Bisher habe ich es nur in Reportagen gesehen – nun werde ich selbst an so einer Reportage mitarbeiten. Eine riesige Ehre – doch meine Angst, mich bei den strahlenkranken Menschen anzustecken, sitzt tief. Seit Wochen träume ich von kranken, verseuchten, röchelnden Menschen, die mich aus leeren Augen anstarren. Meine Hände beben und ich verknote meine Finger ineinander. Ich muss es durchziehen.
Herr Dvorak spürt, dass ich mit den Gedanken woanders bin, und setzt das Gespräch nicht fort. Ich ziehe meine Kamera aus meiner Aktentasche, um erneut Akku und Einstellungen zu kontrollieren. Natürlich gehört sie nicht wirklich mir, sondern ist eine Leihgabe, weil das Kollektiv Privatbesitz verpönt.
Der Zug verlangsamt sich und ich blicke nach draußen auf die weißen Hochhäuser des Quartiers. Ich war so vertieft in meine Kamera, dass ich von der Ankunft völlig überrascht bin. Der Zug kommt viel früher zum Stehen, als mir lieb ist. Wir sind da.
Mit meiner Aktentasche unter einer Achsel hieve ich meinen Koffer die steile Zugtreppe hinab, wobei er an jeder Metallstufe hängen bleibt. Wieso zum Teufel ist dieser Koffer so unfassbar schwer, obwohl ich kaum mehr als drei Dinge besitze? Kurz bevor der Kampf mit meinem Gepäck droht, in einem Sturz die Treppe hinunter zu gipfeln, wird mir das Gewicht aus den Händen gehoben. Fast plumpse ich zurück in den Zug, weil plötzlich das Gegengewicht fehlt.
Ein junger Soldat hält meinen Koffer ohne große Anstrengung. Er ergreift mit seiner freien Hand die meine, um mich die letzten Schritte hinunter zu geleiten. Wie in einem der wenigen alten Filme, die ab und zu am Kinoabend gezeigt werden. Ich verkneife mir ein schrilles Quietschen angesichts seiner Forschheit. Nur das Erröten kann ich nicht unterdrücken. Ich weiß nicht, ob ich geschmeichelt oder peinlich berührt sein soll.
»Wunderbar, wunderbar!«, ruft Herr Dvorak und klatscht die Hände zusammen. »Dann sind wir ja alle versammelt.« Er eilt zu uns, so schnell seine stämmigen Beine seinen noch stämmigeren Rumpf tragen können.
Der junge Soldat dreht sich abrupt zu ihm und salutiert. »Herr Intendant Dvorak, ich heiße Sie willkommen im Inferior Quartier des Kollektivs. Hamish mein Name. Ich stehe als Ihr Begleiter für die Dauer der Reportage zur Verfügung.«
Herr Dvorak winkt beschwichtigend ab. »Na, na, mein Junge. Nicht so förmlich.« Dann klopft er Soldat Hamish auf den Rücken, der unter der Pranke einknickt. Ich vergesse immer schnell, dass Herr Dvoraks Kraft, die er durch die Strahlung erhalten hat, tatsächlich genau das ist: Kraft. Ich kenne das genaue Ausmaß seiner Stärke nicht, vermute aber, er kann meinen Koffer mit einem Finger stemmen. Er muss nicht wie die anderen Superior Sport treiben, um seine Muskeln zu behalten. Vielleicht ist er deshalb so … massig. Man merkt nicht, was hinter seiner runden Fassade lauert. Er lässt zum Glück von Soldat Hamish ab, bevor dieser nicht mehr in der Lage ist, uns bei unserem Auftrag zu begleiten. »Aber ich empfehle Ihnen, sich mit den Berührungen bei Fräulein Bonnet zurückzuhalten«, fügt Herr Dvorak hinzu.
Soldat Hamishs Augen huschen zu mir, dann öffnet er seine Lippen ein paar Mal, bevor er antwortet. »Herr Intendant Dvorak, Fräulein Bonnet, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Meine Intention war es niemals, das werte Fräulein auf unangebrachte Weise … Ich wollte lediglich meine bescheidene Hilfe …«
Doch Herr Dvorak unterbricht ihn. »Junge, lassen Sie diese höflichen Floskeln. Um Fräulein Bonnets Tugend mache ich mir keine Sorgen. Es ist eher Ihre eigene Gesundheit, die mir Sorge bereitet. Seien Sie froh, dass Fräulein Bonnet ihre Schutzhandschuhe trägt. Sie mag unschuldig aussehen, aber ihre Berührung kann sehr schmerzhaft für Sie enden.«
Soldat Hamish schluckt. Wie immer breitet sich ein bitterer Geschmack in meinem Mund aus, sobald das Gespräch auf meine Kraft gelenkt wird. Als ob sich eine Kapsel Medizin in meinem Rachen auflöst, die ich nicht schlucken, aber auch nicht ausspucken kann. Ich vermeide das Thema, um anderen keine Möglichkeit zu geben, auch nur ansatzweise über mich und meine Fähigkeit nachzudenken.
Für andere Superior sind ihre Kräfte etwas Alltägliches. Weder ein Grund für Hochmut noch um sich deswegen zu schämen. Egal, ob sie Möbel schweben lassen oder nur die Farbe ihrer Augen ändern können, jeder kann sich und seine Fähigkeiten einbringen. Nicht nur die Kräfte, die sie durch die Genmutation nach dem Atomkrieg erhalten haben, sondern auch alle anderen Talente. Dank dem Kollektiv fühlt sich niemand nutzlos. Sogar die Inferior sind nicht weniger wert als wir, niemand wird besser behandelt. Nicht wie früher. In der Alten Welt besaßen manche Menschen so viel, dass sie mehrere Häuser brauchten, um alles zu lagern. Und andere mussten sich auf den Straßen durchschlagen. Im Kollektiv gibt es solche Unterschiede nicht. Jeder gibt dem Kollektiv das, was er gut kann, und bekommt, was das Kollektiv entbehren kann. Wir sind ein Teil von etwas Größerem. Nur ich gehöre nicht zu diesem Größeren. Meine Eltern dachten bis zu meiner Registrierung, ich sei eine Inferior, weil ich keine Anzeichen einer Kraft zeigte. Sie untersuchten heimlich mein Blut in ihren Labors und die Wahrheit erschütterte sie noch mehr. Weder Superior noch Inferior, sondern eine Anomalie. Durch und durch normal, wie die Menschen der Alten Welt. Und deshalb rede ich nicht gern über meine Kraft. Weil ich dem Kollektiv nichts gebe, außer Lügen.
Ich will Soldat Hamish beruhigen und ihm klar machen, dass Herr Dvorak übertreibt. Dank der Stoffhandschuhe stellen auch zufällige Berührungen keine Gefahr dar. Doch ich bringe kein Wort heraus. In meinem Kopf finde ich schnell die richtigen Worte, aber sobald ich anderen Menschen gegenüberstehe, verschwimmen die Vokabeln und Sätze in mir. Weshalb ich auch eine Laufbahn hinter der Kamera anstrebe, statt davor.
Soldat Hamish entschuldigt sich noch mehrmals, abwechselnd bei mir und Herrn Dvorak. Immer noch so übertrieben höflich, dass Herr Dvorak sich dazu entscheidet, ihn einfach zu ignorieren. Stattdessen deutet er uns beiden mit einer Handbewegung an, ihm zu folgen. »Es wird Zeit, dass wir unser Lager für die kommenden Nächte beziehen. Wir wollen doch zeitig mit der Reportage anfangen. Ihr großer Durchbruch als Journalistin, nicht wahr, Margo?« Perfekt, noch mehr Druck. Genau das, was ich brauche.
Der Bahnhof ist abgesehen von uns menschenleer. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber der Bahnhof könnte ein Replikat unseres Bahnhofs im Gewölbe sein. Blassgrauer Beton soweit das Auge reicht, ab und zu unterbrochen von Eisenstreben. Wir treten auf die Hauptstraße, die genauso aussieht wie unser kreisrunder Boulevard im Gewölbe. Links und rechts flankieren die ewig gleichen Hochhäuser aus weißem, ressourcenschonendem Material den Weg. Nur gegenüber dem Bahnhof sticht das Institut des Verwaltungshexagons heraus. Ein mit dem Lineal gezogener Betonklotz, dessen tausend Fenster auf mich hinab starren. Also haben sie hier sogar die gleichen sechs Hauptgebäude, wie bei uns im Gewölbe.
Durch eine automatische Glastür treten wir in die luftige Vorhalle. Obwohl keine teuren Materialien verbaut sind, schrumpfe ich zu einer kleineren, unbedeutenderen Version von mir zusammen, während wir die weißen Flure betreten, überall von Glas und Metall umgeben. Als müsste ich durch eine riesige Version meiner ungeheuer teuren Kamera laufen, immer darauf bedacht, keines der Teile zu zerscheppern.
Herr Dvorak hält einen Monolog über die Organisation dieses Instituts, den ich ausblende. Mitarbeiter huschen durch die Flure, alle mit einer angeborenen Wichtigkeit, sodass ich sie niemals für Inferior gehalten hätte. Doch alle Bewohner hier sind Inferior. Wo sind die verseuchten Kranken aus meiner Vorstellung? Vielleicht verbergen sie ihren Zustand unter den starr gebügelten Anzügen. Immerhin breche ich nicht in Angstschweiß aus, da keiner von ihnen uns nahekommt. Noch nicht.
Während ich in bange Vorahnungen versinke, passieren wir eine Überwachungsstelle, deren Detektoren aufschrillen, sobald ich sie durchquere. Mein Herz setzt aus und meine Beine erstarren. Die Sirenen verdrängen alle anderen Geräusche aus meinen Ohren, auch die abgehakten Anweisungen der Sicherheitsangestellten. Ich muss auf der Stelle umkehren, aus dem Gebäude stürmen. Der Detektor erkennt, dass ich keine Superior bin. Ich muss hier weg.
Doch mehrere Hände halten mich zurück. Sie zerren so effektiv und grob an meiner Kleidung und mir, dass die Berührungen nicht beschämend sind, sondern einfach nur erniedrigend.
»Keine Sorge, Margo«, versucht Herr Dvorak mich zu beruhigen, doch ich höre ihn dank des schrillen Fiepens in meinen Ohren kaum. Fremde Menschen zerren die Kamera aus meiner Aktentasche, offensichtlich der Übeltäter, denn ohne sie kann ich problemlos den Detektor durchqueren. Zahlreiche Entschuldigungen seitens der Sicherheitskräfte rauschen an mir vorbei. Jemand drückt mir die Kamera zurück in meine zitternden Hände. Doch mein Herz hört nicht auf, im Takt des Detektorschrillens zu pumpen, obwohl die schreckliche Situation nur wenige Sekunden gedauert haben kann. Ich atme tief ein und aus, während Herr Dvorak mich weiterschiebt, bis ich wieder klar denken kann. Ein dämlicher Metalldetektor und ich verliere vollkommen die Fassung. Meine Ohren werden warm und ich weiche den Blicken der anderen aus.
Ich hätte mich nicht dazu entscheiden sollen, Journalistin zu werden. Ein anderer Job, mit weniger Kontrollen und unauffälligerem Tagesablauf, wäre die bessere Wahl gewesen. Das wusste ich schon, bevor meine Eltern täglich versuchten, mich von meiner Idee abzubringen. Doch was wäre die Alternative gewesen? Sicherlich nicht die Anstellungen im Militärhexagon, die mir dank meiner zerstörerischen Kraft zur Auswahl standen. Als Soldatin wäre mein Tag auf andere Weise gefährlich. So oder so – tief in mir weiß ich, dass mein Beruf die Gefahr wert ist. Meine Faszination damit, Neues zu entdecken und es anderen zu zeigen, drängt mich seit Jahren zum Journalismus.
Soldat Hamish bleibt erneut unter Salutieren und Halbverneigungen stehen. »Fräulein Bonnet, Herr Intendant, Ihre Unterkunft.«
Ruckartig blicke ich auf. Unterkunft, nicht Unterkünfte? Ich unterstelle Herrn Dvorak keine unlauteren Absichten. Aber das Zimmer mit einem Mann teilen, der nicht Teil meiner Familie ist? Undenkbar. Ich bin mir sicher, das verstößt sogar gegen das Protokoll.
»Kein Grund für so ein erschrockenes Gesicht!« Herr Dvorak lacht schallend. »Natürlich zieht jeder von uns in ein Einzelzimmer!« Wie unangenehm, dass er meine Gedanken sofort durchschaut.
Wir treten in einen schmalen Flur, von dem aus mehrere Einzelzimmer abgehen. Unsere Schuhe erzeugen keine Geräusche auf dem weinroten Teppich und meine Augen brauchen einen Moment, um sich an das schummrige Licht zu gewöhnen. Herr Dvorak betritt das Zimmer am Ende des Flurs, als wäre es sein Zuhause. Vielleicht bezieht er sein Stammzimmer, da er nicht zum ersten Mal hier arbeitet.
»Hier entlang zu Ihrer Unterkunft, Fräulein Bonnet.« Soldat Hamish öffnet mir die Tür neben Herrn Dvoraks Zimmer, hastet eifrig hinter mir her, während ich mich im Zimmer umschaue, und stellt den Koffer neben einem Wandschrank ab.
Ich hatte eine Unterkunft ähnlich einer Gefängniszelle erwartet, praktisch und nur für einen kurzen Aufenthalt gedacht. Auf jeden Fall kein geräumiges Zimmer mit Ausblick auf eine Grünfläche. Kein seidenbezogenes Bett. Sogar ein Gemälde hängt an der makellos verputzten Wand, auf dem ich das Relief der Farbschichten und Pinselstriche erkenne. In meiner Wohnung habe ich kein einziges Bild. Selbst meine Eltern besitzen nur einen winzigen Kunstdruck vom Symbol des Gewölbes, ein schwarzes Sechseck mit zwei ineinandergreifenden, dünnen Linien, die für die Zusammenarbeit von Superior und Inferior stehen. Und das Bild wird jedem Paar zur Hochzeit geschenkt.
»Hier schlafe ich?« Ich kann es nicht fassen.
»Wenn etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit ist, werde ich mich sofort darum kümmern«, setzt Hamish an.
Ich schüttle meinen Kopf so heftig, dass ein Nackenwirbel knackt. »Nein, nein, alles ist in Ordnung!«, unterbreche ich ihn. Mehr zu verlangen, als mir von der Obrigkeit zugedacht wurde, wäre ein Verbrechen.
»Falls Sie dennoch irgendetwas benötigen …« Er salutiert erneut und blickt mich unsicher an. Sein unvollendetes Angebot bleibt einige unangenehme Sekunden im Raum stehen. Dann räuspert er sich. »Die Expedition beginnt in knapp zehn Minuten. Der Herr Intendant wünscht, dass wir uns alle im Foyer einfinden.«
Ich ziehe meine Augenbrauen hoch. »Sie begleiten uns bei der Reportage?« Die Frage rutscht mir einfach so heraus. Ich stelle eigentlich nicht viele Fragen, denn im Gegenzug dafür werde ich auch wenig gefragt.
»Zu Ihrer Sicherheit und für einen reibungslosen Ablauf. Sie werden mich nicht bemerken. Außer Sie benötigen etwas, wie gesagt, dann -«
»Dann melde ich mich bei Ihnen.« Ich schneide ihm das Wort ab. Auch etwas, das ich normalerweise nicht tue. Das liegt garantiert an meiner Nervosität. Ich zupfe an der Handschuhnaht an meinem Daumen herum. »Ist es denn gefährlich hier?«
»Nein, natürlich nicht. Reine Vorsichtsmaßnahmen.« Er kreuzt beschwichtigend die Hände vor seiner Brust und schüttelt seinen Kopf. Ein paar Mal zu oft, wie ich finde. Er überlegt einen Moment. »Um ehrlich zu sein, meine Anwesenheit ist eher reine Formalität. Falls Fragen aufkommen oder die Herrschaften etwas benötigen.« Soldat Hamish fühlt sich sichtlich nutzlos, was mich beruhigt. Er blickt auf die Uhr über einem kleinen Sekretär aus dunklem Holz. »Falls Sie soweit zurechtkommen, lasse ich Sie jetzt allein. Meine Empfehlungen.« Mit einem letzten Salutieren verlässt er das Zimmer.
Sofort lasse ich mich rückwärts in die Matratze sinken. Kaum zwanzig Minuten im Quartier und schon häufen sich die Fragen. Und das flaue Gefühl in meinem Magen breitet sich weiter aus, steigt mir den Hals hinauf. Was soll ich von diesem Zimmer halten, das im Vergleich zu meiner Wohnung, sogar zu der größeren Wohnung meiner Eltern, wie ein Palast wirkt? Dieser Luxus beunruhigt mich. Wenn ich zu Hause so ein Bett hätte, wäre ich längst des Hochverrats angeklagt worden.
Gut, das ist etwas übertrieben. Aber ein Disziplinarverfahren wegen Verstoßes gegen das Protokoll wäre garantiert angemessen für so ein Vergehen. Ich erinnere mich noch haargenau an den Tag vor zwölf Jahren, als Dora Hardecks Eltern ihr einen Wachsmalstift besorgt hatten, mit dem sie im Kunstunterricht goldglitzernde Sterne zeichnen konnte. Dora durfte zwei Wochen nicht in die Primärschule. Ihre Eltern sitzen mittlerweile im Zwinger, unserem Gefängnis, wegen Untergrabung des sozialen Gedankens. Natürlich nicht allein wegen des Wachsmalers, der war nur die Spitze des Eisbergs. Jeder scheint so eine Familie zu kennen, die aus Hochverrätern oder zumindest Gesetzesbrechern besteht. Egal, wie klein die Vergehen am Anfang sind, am Ende wird aus einem Wachsmaler ein verbotener Gedichtband der Alten Welt. Die schlimmste Straftat: Das geschriebene Wort, das uns zur Sünde verleitet.
Was aus Dora Hardeck wurde, weiß ich nicht. Sie war bis zum Ende der Primärschule Teil meiner Klasse. Danach nicht mehr. Nicht alle ehemaligen Klassenkameraden sieht man in der Sekundarschule, wo wir auf unsere Berufe vorbereitet werden, aber die meisten trifft man dennoch bei Sportwettkämpfen oder am Kinoabend. Dora habe ich nie wiedergesehen. Dora, die Wunden heilen konnte. Was für eine fantastische Kraft, einfach so verschwendet. Meine Hand streicht in Gedanken an Dora über die weiche Seidenbettdecke. Ich bezweifle, dass sie jemals etwas auch nur ansatzweise so Prunkvolles besaß wie dieses Bett. Dieses Zimmer. Und trotzdem ist etwas mit ihr geschehen, über das ich nicht nachdenken will. Beklommenheit kratzt unerlässlich an der Innenseite meines Halses. Wie konnten Doras Eltern diese Angst aushalten, während sie sich mehr und mehr Luxus anhäuften?
Jemand klopft so laut an der Tür, dass es schmerzen muss.
»Herein!« Meine Hand bildet eine Faust in der Bettdecke. Hastig löse ich meine Finger, streiche die knittrigen Falten im Stoff glatt.
Herr Dvorak streckt seinen Kopf durch den Türspalt. »Margo, sind Sie soweit?«
Ich springe auf. »Ich bin in einer Minute bei Ihnen«, stammle ich. Hastig kontrolliere ich meine Aktentasche, in der sich alles an seinem vorgesehenen Platz befindet. Kamera, Stofftaschentuch, Tablet, Proteinriegel für Notfälle … und ganz unten, versteckt in einer Packung Damenhygieneartikel: die Handschuhe. Der Anblick schüttelt mich wie immer. Bilder des schmerzverzerrten Gesichts des Inferior steigen in mir auf, also schiebe ich die Packung noch tiefer in die unterste Ecke der Tasche. Ich sollte sie öfter anziehen, nicht nur zur Sicherheit bei mir tragen. Aber es bleibt keine Zeit mehr, mir darüber den Kopf zu zerbrechen. Also stakse ich mit meiner Aktentasche und einem knittrigen Gesicht aus dem Zimmer.
***
»Willkommen im Quartier!« Ein kleiner, dünner Mann, fast schon zart, empfängt uns vor dem Institut. Buchstäblich mit offenen Armen. Ich befürchte, er will uns alle an sich drücken, und verstecke mich unauffällig in Herrn Dvoraks Schatten. Wäre nicht das erste Mal, dass mich dieser Schachzug unsichtbar macht. Aber der Mann schüttelt nur die Hand meines Chefs und salutiert Hamish, so ungeschickt und ausladend, als parodiere er ihn. Doch er strahlt uns alle herzlich an, sodass ich nicht anders kann, als ebenfalls zu lächeln.
»Meine Dame, ich glaube, wir hatten das Vergnügen noch nicht? Gilbert Alois mein Name!« Bei seinem Namen atme ich auf. Er ist der Superior aus dem Gewölbe, der uns hier herumführen wird. Auch wenn ich nicht verstehe, warum er nicht mit uns hier her gefahren ist. Alois tänzelt um Herrn Dvorak herum und ergreift meine Hand zu einem Handkuss. »Sie müssen das Wunderkind sein, von dem Valentin – ich meine natürlich Herr Dvorak – immer schwärmt. Fräulein Bonnet, kleines Genie der Bilder, nicht wahr?« Er zwinkert mir verschmitzt zu. Sein rosiges Gesicht strahlt und er wirkt jünger, als es die leichten Lachfalten um den Mund erahnen lassen.
Ich muss mich nicht im Spiegel betrachten, um zu wissen, wie knallrot ich anlaufe. »Ja, Margo Bonnet, freut mich sehr. Aber Herr Dvorak muss gescherzt haben, als er -«
Alois winkt ab und unterbricht mich, fast schon ruppig, aber ich kann es ihm nicht übelnehmen. »Ach iwo! Dvorak ist beileibe immer zu Scherzen aufgelegt, aber über Sie spricht er nur in den höchsten Tönen. Schlaues Mädchen, auffallend schlaues Mädchen. Und so engagiert! Eine wahre Bereicherung für das Kollektiv, nicht wahr?« Er schwallt weiter auf mich ein, sodass ich erst auf den zweiten Blick erkenne, dass wir auf ein Auto zugehen. Ein Auto. Ich bin noch nie in einem gefahren, doch das ändert sich wohl heute. Und dieses hier sieht überhaupt nicht aus wie die klapprige Rostmühle vom Rationsladen, in dem der Leiter Herr Chow ab und zu Lebensmittel zwischen den Hexagonen transportiert. Der nachtschwarze Lack dieses Auto ist poliert wie die Glasscheiben des Instituts. Es flößt mir panische Angst ein, noch mehr als die Zugfahrt zuvor, bei der unser Gefährt immerhin von Schienen auf Kurs gehalten wurde.
Bevor ich protestieren kann, sinke ich in das glatte Material der Rückbank. Noch durch meine Strumpfhose und den Rock spüre ich die Kälte des Sitzes. Ich lande in der Mitte, eingequetscht zwischen Soldat Hamish und Alois. Der Motor röhrt auf, ganz anders als das ebenso laute, aber weniger zerstörerische Startgeräusch des Zuges. Statt in die Oberschenkel meiner Sitznachbarn zu kneifen, müssen meine eigenen Knie herhalten.
»Na, Ihre erste Fahrt?«, kichert Herr Alois. »Aufregend, nicht wahr?«
»Ja, große Klasse«, versuche ich mich begeistert zu geben. Immerhin läuft auch Hamish im Gesicht kalkweiß an, während der Fahrer durch eine scharfe Kurve steuert.
Das hier ist verrückt. Wirklich ganz und gar wahnsinnig. Ich sitze in einem Auto. Erst das Zimmer und jetzt eine Autofahrt! Ich will Herrn Dvorak unauffällig auf den ganzen Prunk ansprechen, aber er sitzt vorn und ich müsste brüllen, um das Getöse des Autos zu übertönen. Es wäre unklug, direkt vier Menschen meine Bedenken mitzuteilen. Man weiß nie, was andere Menschen in die eigenen Aussagen hineininterpretieren. Worte müssen genauso rationiert werden, wie Lebensmittel. Vielleicht kann ich Hamish vorsichtig befragen? Er wirkt harmlos genug.
»Soldat Hamish?«, flüstere ich.
»Ja?« Er springt in seinem Sitz auf, soweit es der Gurt zulässt.
»Ich frage mich, ob eventuell eine Verwechslung bei den Unterkünften stattgefunden hat?« Das wäre eine Erklärung. Das Zimmer kann nicht für mich gedacht sein. Es wäre unrecht, so einen Fehler auszunutzen.
»Ein wunderschönes Zimmer, oder?«, klinkt sich Herr Alois in das Gespräch ein. Soviel zum Thema, nicht sämtliche Leute einzuweihen.
»Ja, wirklich schön«, stimme ich zu und vergesse, worauf ich hinauswollte. Sogar das unhöfliche Einmischen in unser Gespräch nehme ich Herrn Alois nicht übel. Wieso fühle ich mich plötzlich so ruhig? So zufrieden? Ich versinke in Gedanken an das schöne Bett, das schöne Gemälde, die schöne Aussicht.
Keine fünf Minuten später tritt der Fahrer auf die Bremse und der Wagen stottert in einen unsanften Halt. Ein erschrockenes Einatmen kann ich mir nicht verkneifen, denn diese Strecke hätten wir problemlos zu Fuß laufen können. Wer kommt auf die Idee, dafür ein Auto zu benutzen?
An einem weiteren, kleineren Bahnhof steigen wir in einen Zug um, der uns zu den Feldern fährt. Immerhin für eine angemessene Zeitspanne. Wir müssen einen strengen Zeitplan einhalten, deshalb sind diese Fahrten vielleicht einfach notwendig. Ein wenig erleichtert lasse ich mich in meinen Sitz im Gemeinschaftsabteil sinken. Alles hat seinen Sinn. Draußen ziehen verdorrte Wiesen ohne einen einzigen Baum oder auch nur einen Busch an uns vorbei. Mehr hat der Atomkrieg nicht übriggelassen. Den jähen Wunsch, mich ganz hinten am grauen Horizont in das brüchige Gras zu legen, weit weg von anderen Menschen, zwänge ich tief hinunter.
***
Im makellosen Verteilungswerk tüfteln Inferior an Fließbändern und Holotischen, die mehrere Hektar große Feldanlagen projizieren. Inferior, die von einer Arbeitsstation zur nächsten huschen und deren blassgraue Kittelärmel mich streifen. Mein Magen dreht sich. Ich hoffe, Herr Dvorak wird nicht im Arbeitsreport vermerken müssen, dass ich mich auf das Fließband übergebe. Deshalb reiße ich mich zusammen. Zum Glück achtet niemand auf mich, da alle das komplexe Leitungssystem bestaunen, welches Alois uns erklärt.
»Aufgeregt wegen des ersten Auftrags?«, fragt nur Herr Dvorak schmunzelnd, als mein Vitaband am Handgelenk durch ein Piepen auf meinen zu hohen Puls hinweist. Ich atme bewusst langsam, um meinen Herzschlag herunterzubringen.
»Ja, alles ist so neu für mich«, gebe ich zu, doch das ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe Angst davor, von den Inferior angesteckt zu werden. Eigentlich verbleibt in ihren Körpern so wenig Strahlung, dass sie für Superior ungefährlich ist. Zumindest für normale Superior. Und sogar die meiden Inferior. Ob ich ebenfalls immun bin? Das werde ich erst bemerken, wenn mein Körper anfängt, sich zu zerstören. Aber jetzt ist es zu spät für Zweifel wegen meiner Anomalie. Oder meiner genetischen Normalität, wenn man es aus der Perspektive der Alten Menschen betrachtet. Menschen, welche die Zusammensetzung meiner Gene teilten. Und jetzt tot sind. Hör mit diesen Gedanken auf, Margo!
»Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie gut können. Filmen Sie und machen Sie sich Notizen.« Ein wohlgemeinter Rat, der alles andere als einfach ist. Das Filmen bereitet mir keine Probleme. Den Fokus der Linse setze ich so mühelos wie meine eigenen Augen zwischen nah und fern wechseln. Meine Hände finden den perfekten Zoom für die winzigen Keimlinge auf den silbernen Fließbändern. Beim Filmen glänze ich. Schwierigkeiten bereiten mir die Notizen. Gleichzeitig filmen, Alois’ Erklärungen lauschen und dabei die ungewohnten Ikonogramme der Kollektivschrift in mein Tablet eingeben. Und alles, ohne diese furchtbar teure Kamera fallen zu lassen.
»Auch wenn Sie das Schreiben gelernt haben«, flüstert Hamish mir zu, »nimmt es Ihnen niemand übel, wenn es beim ersten Mal nicht perfekt klappt.« Sein Barrett hält er hier im Gebäude in den Händen. So unsicher er auch ist – eine Unsicherheit, die mich irritiert, weil sie mich an meine eigene erinnert – er verhält sich immer nach Protokoll. Höflichkeit schätze ich an jedem Menschen. Und er hat vermutlich Recht. Das Schreiben habe ich erst vor wenigen Jahren am Ende meiner Ausbildung gelernt. Erst als sich die Inspekteure sicher waren, dass ich genug moralische Standhaftigkeit und Kollektivtreue in mir vereine, um mich nicht von der Schrift vereinnahmen zu lassen. Damit gehöre ich zu den wenigen im Kollektiv, die gut lesen und sogar ein wenig schreiben können. Aber in einem Studierzimmer vorgegebene Sätze in ein Tablet einzutragen, hat nichts mit diesem hastigen Tippen zu tun. Ich gerate jetzt schon völlig außer Atem.
»Ich würde meine Wochenration an Lebensmittelmarken darauf verwetten, dass in meinen Notizen später Sätze stehen, die niemand mehr entziffern kann«, flüstere ich zurück. »Wenn ich es nicht noch schaffe, versehentlich alle Daten zu löschen.«
Hamish prustet in seine Hand und ich muss grinsen. Wirklich witzig war das nicht und sein Lachen wirkt etwas aufgesetzt. Aber ich bin ihm dankbar für den Versuch, mich aufzumuntern. Und tatsächlich merke ich, wie sich meine Schultern lockern. Herr Dvorak wirft uns einen Blick zu, der zwischen Strenge und Belustigung schwankt. Hamish fühlt sich sichtlich ertappt und hastet mit gesenktem Kopf hinter den beiden Männern her.
Ich folge den anderen in einen dämmrigen Gang. Durch lange Sichtfenster erhasche ich Blicke auf ein Labor mit tausenden Geräten. Und Pflanzen, überall Getreide, Kräuter und Setzlinge, die draußen traumhaft aussehen würden, unter dem fluoreszierenden Licht aber an geschmolzenes Plastik erinnern. Eine Topfpflanze mit fetten Blättern und Früchten, die vor Reife schimmern, steht neben einem vertrockneten Stock, der zur gleichen Gattung zu gehören scheint. Sie erinnern mich an Superior und Inferior. Wie meine Pflanze wohl aussehen würde?
»Es ist wundervoll, was wir hier mit den Pflanzen der Alten Welt zaubern können«, fährt Alois mit ausladenden Armbewegungen fort. »Gewächse, die kurz vorm Aussterben sind, werden hier widerstandsfähig gegen Schädlinge und Strahlung gemacht.«
»Wie genau wird das gemacht?« Ich schlage meine Hand vor den Mund. Die Frage ist mir einfach so herausgerutscht, weil mich Alois Begeisterung ansteckt. »Entschuldigen Sie bitte vielmals! Ich wollte Sie nicht unterbrechen, Herr Alois«, murmele ich schnell hinterher.
Er dreht sich zu mir, ebenso wie Herr Dvorak und Soldat Hamish. Vielleicht können die Wissenschaftler auch mich widerstandsfähiger gegen diese Aufmerksamkeit machen, denn ich würde am liebsten flüchten.
»Kein Grund zur Entschuldigung, ich freue mich über Ihr Interesse!« Unaufgefordert eine Frage heraus zu plappern, ist definitiv gegen das Protokoll, aber es scheint ihn ehrlich zu freuen. »Wir nutzen Mutagenese, um die Anpassung der Pflanzen an die äußeren Umstände zu beschleunigen. Absolut natürlich! Vor dem Krieg haben die Menschen für so etwas Chemikalien über die Pflanzen geschüttet. Keine schöne Angelegenheit.« Ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass er überhaupt nicht versteht, was er von sich gibt.
»Lassen Sie mich raten«, wirft Dvorak ein. »Wir lösen das heute etwas eleganter?« Ich filme den Austausch zwischen ihnen. Keiner der beiden ist rein optisch gesehen dafür geeignet, vor der Kamera zu stehen, aber ihre Art steckt an. Ein eingespieltes Team.
»Ganz richtig, mein Guter. Mit ionisierten Strahlen werden kleinste Moleküle abgetrennt und durch besseres Erbgut ersetzt. So reichen die wenigen Flächen, die uns nach dem Atomkrieg blieben, um uns zu ernähren.« Weil es jahrelang an Nahrung mangelte, starben mehr Menschen, als durch den Krieg selbst. Noch jetzt kommt es manchmal zu Lebensmittelknappheiten, die dank dieser Forschung der Vergangenheit angehören könnten. Aber das, was er da sagt, klingt ganz so als ob …
»Also benutzten Sie im Grunde genommen radioaktive Strahlung, um unsere Lebensmittel zu verändern?« Oh verdammt. Ich halte meine Kamera fester, um sie nicht fallen zu lassen. Mir fällt nichts ein, um diesen Fauxpas abzuschwächen. Es war nur ein Gedanke. Aber sobald er mir herausgerutscht ist, klingt er nach Missbilligung der vom Kollektiv genehmigten Forschung. Ich starre auf den Boden, stähle meinen Geist, da gleich garantiert eine Schar von Soldaten hereinstürmt, um mich festzunehmen. Doch es bleibt ruhig, kein Knallen von Stiefeln auf dem Linoleumboden. Ich zwinge meinen Kopf Wirbel für Wirbel zurück in eine aufrechte Position.
Niemand verhaftet mich, aber auf den drei Gesichtern vor mir stelle ich unterschiedliche Grade des Entsetzens fest. Hamish sieht genauso erstarrt aus, wie ich mich fühle, Herrn Dvoraks Blick kann ich, abgesehen von der offensichtlichen Überrumpelung, nicht deuten und Alois gafft mich an, als wachse mir eine seiner Pflanzen aus den Ohren. Doch dann räuspert er sich, lächelt, und mich durchströmt unvermittelt Erleichterung.
»Ich verstehe ihre Verblüffung, junge Dame. Doch ich kann Ihnen versichern, wir nutzen die Radioaktivität nach bestem Wissen und Gewissen. Jede Kraft der Welt kann für das Gute oder das Böse eingesetzt werden, nicht wahr?«
»So habe ich es noch gar nicht betrachtet«, stottere ich erst, dann sprudeln die Worte aus mir heraus. »Unsere Kräfte setzten wir für das Gemeinwohl ein. Aber die Menschen der Alten Welt hätten diese Kräfte missbraucht, so wie sie früher die Strahlung genutzt haben, um anderen Leid zuzufügen. Wenn wir unsere persönlichen Kräfte jetzt für gute Zwecke nutzen können, dann natürlich auch die Strahlung.« Ich halte den Atem an. Konnte ich mich herausreden?
Alois wendet sich Herrn Dvorak zu, mit wohlgesonnenem Nicken. »Ich sehe, warum Sie so angetan von Ihrer kleinen Assistentin sind. Wirklich ansprechende Wortwahl, wenn auch noch etwas unbeholfen in der Kunst des Gesprächsbeginns.« Er bricht in Gelächter aus, in das Herr Dvorak einstimmt.
Sie gehen weiter und Herr Dvorak winkt ab. »Technische Kleinigkeiten, die sie in kürzester Zeit meistern wird.«
Während ich ihnen folge, hebe ich beinahe vom Boden ab. Keine Gefahr durch die Pflanzenbestrahlung. Keine Konsequenzen für meine Worte. Alles ist gut. Trotzdem wende ich mich noch ein letztes Mal zu den Sichtfenstern, die den Blick auf Maschinen, Mikroskope und Strahlenmesser freigeben. Das Fensterglas erscheint längst nicht massiv genug.
***
Kurz bevor wir das Gebäude auf der Rückseite verlassen, steckt man uns in schwere Strahlenanzüge. Eine eigentlich unnötige Sicherheitsmaßnahme, betont Alois. Doch als unechte Superior bin ich dankbar für die Bleischicht zwischen mir und der Luft. Dann treten wir durch eine Metalltür nach draußen.
Kilometerweit erstrecken sich grüne und sonnengelbe Pflanzen bis zum Sonnenuntergang. Das absolute Gegenteil zu den sparsam parzellierten und gestutzten Grünflächen im Gewölbe. Auf den Feldern arbeiten Inferior mit gebeugten Rücken. Von ihnen geht Strahlung aus, aber vor allem von der Umwelt.
Sie zu beobachten, macht mich krank. Also blende ich sie aus und lasse meinen Blick und den meiner Kamera über die Natur schweifen. Bald schon steigt keine Säure mehr meine Speiseröhre hinauf. »Die Felder sind wunderschön. Perfekt zum Filmen«, schwärme ich, obwohl ich den Rest der Führung nicht mehr stören wollte. Ich spüre sogar kaum noch den schweren Strahlenanzug, der mich zuvor heruntergezogen hat.
Alois führt uns durch die Felder, einen breiten Weg aus Beton entlang. »Hier sammeln die Arbeiter das geerntete Obst, Gemüse und Getreide ein«, erklärt Alois und ich schwenke die Kamera hastig auf ihn. Hoffentlich kann der Bildstabilisator mein Gewackel ausgleichen.
Die Inferior kümmern sich um die Landwirtschaft, weil das Gewölbe von Ruinen der Alten Welt umgeben ist und keinen Platz für Ackerland bietet. Deshalb kann ich die Feldfrüchte nicht unterscheiden. Bei uns im Gewölbe kommen sie in perfekt rationierten Portionen an, zermahlen oder zu Mus verarbeitet. Die Früchte hier sehen nicht essbar aus, sondern wie Plastik. Trotzdem reizt es mich, in einen dieser knallgelben Halbmonde zu beißen. Einfach um zu wissen, ob sie sich auf der Zunge anders anfühlen als püriertes Obst.
Wir halten vor einem Feld, in dem mindestens zwanzig Inferior gigantische Messer durch die Luft schwingen. Die Synchronität der funkelnden Klingen hypnotisiert mich. Die Inferior schneiden das hochgewachsene Gras ab, obwohl es ausgedörrt und absolut nicht essbar aussieht. Vielleicht jäten sie Unkraut.
»Sie ernten Weizen«, erklärt Alois, als könne er meine Gedanken lesen. Er deutet auf das Feld mit dem Weizen, das in meinem Hinterkopf als Getreide abgespeichert liegt. Daraus werden Brotlaibe hergestellt, soviel habe ich in der Schule gelernt, auch wenn man uns nie das passende Bild dazu gezeigt hat. Ich versuche, ihm nicht allzu genau zuzuhören. Nachher stelle ich noch eine weitere unangebrachte Frage. Stattdessen filme ich abwechselnd ihn, einzelne Arbeiter und das goldene Getreide vor dem tiefroten Sonnenuntergang. Die Zuschauer lieben Sonnenuntergänge.
Meine Augen bleiben an einem alten Inferior hängen, der noch ein wenig gebeugter über das Feld stolpert, als die anderen. Als könne er sich nicht mehr aufrichten, auch nicht ohne das Gewicht des riesigen Werkzeugs in seinen Händen. Er ist wirklich erstaunlich alt, denn ich erkenne die tiefen Falten und das schneeweiße Haar, ein starker Kontrast zu seiner dunklen, sonnengegerbten Haut, sogar aus der Entfernung. Er muss kurz vor seinem Gnadenstand stehen.
Beim Anblick von alten Menschen wird mein Herz immer schwer. Auch jetzt spüre ich das Brennen hinter meinen Lidern, während ich ihn für seinen Einsatz bewundere. Ich reiße meine Augen auf, damit beim Blinzeln keine verräterischen Tränen herauskullern. Ich wünsche dem alten Inferior, dass er den Rest seines Lebens genießen kann, wenn seine Zeit gekommen ist. Wenn er in den Gnadenstand tritt, ein gemütliches Häuschen erhält und dazu alles, was er sich nur wünschen kann, als Dank für seine jahrzehntelange Arbeit.
Er hebt das Werkzeug immer wieder zu Hieben an, Hiebe, die niedriger und schwächer sind als die der anderen. Er trennt kaum einen Halm ab.
Dann fällt ihm das Messer aus den Händen und er bricht zusammen.
Bevor ich auch nur erschrocken keuchen kann, windet er sich auf dem Getreide, das unter ihm einknickt. Alois verstummt und das gequälte Stöhnen des Inferior weht zu uns. Es vibriert in meinen Ohren, vibriert durch mein Herz. Ich kann nicht wegschauen. Ich kann nicht weghören.
Mich durchdringt die jähe Gewissheit, dass dieser Inferior keinen Gnadenstand mehr erleben wird. Mit zitternden Händen lasse ich die Kamera sinken, Zentimeter für Zentimeter. Mein Blick klebt immer noch auf dem Inferior, dessen Arme und Beine aussehen, als zerbrechen sie gleich. Wächter traben durch das Feld zu ihm und zerren ihn hoch, so grob, dass mir übel wird. Doch dann durchspült mich eine Welle von Gleichgültigkeit, schwemmt die Übelkeit, die Panik, die Fassungslosigkeit fort.
Alois scheucht uns zurück zur Fabrik, obwohl seine Präsentation noch längst nicht beendet ist. Wir sollen nicht sehen, wie der alte Inferior weggezerrt wird. Erst jetzt fällt mir auf, dass keiner der arbeitenden Inferior einen Schutzanzug trägt wie wir. Das ist ungerecht, falsch. Doch seltsam gefasst lösche ich die letzten Minuten meiner Aufnahme. So etwas darf niemand zu Gesicht bekommen.
Kapitel 2
Vier Tage später lasse ich mich von der Zugfahrt zurück in das Gewölbe durchrütteln und bilde mir ein, mich dadurch etwas besser zu fühlen. Abgesehen davon, dass ich meine Füße kaum noch voreinander setzen kann und mein Rücken schmerzt, als hätte ich höchstpersönlich die letzten Drehtage auf dem Feld durchgeackert, quälen mich auch noch meine Gedanken. Der krude Kontrast zwischen dem Leben der Inferior und meinem Zimmer im Quartier, dem Auto sowie dem Essen, das uns gereicht wurde, legt sich als heftiger Schmerz über meine Schläfen. Nicht genug, dass ich mein Leben lang verstecken muss, was ich bin – nun werde ich auch noch anfällig für die Kopfschmerzen meiner Mutter. Fabelhaft, genau das, was ich im Moment brauche.
Der Anfall des Inferior trifft mich jetzt viel härter als zuvor. Vielleicht, weil die Anspannung von mir fällt und den Watteschleier, der sich in den letzten Tagen über mich gelegt hat, mit sich reißt. Oder einfach nur, weil ich endlich einige Minuten für mich habe, die nicht mit Arbeit, kräftezehrenden Gesprächen und ins Bett fallen gefüllt sind. Minuten zum Nachdenken.
Obwohl mein Körper im Sofa des rasenden Todesgefährtes einschlafen möchte, freue ich mich darüber, dass Herr Dvorak ins Gemeinschaftsabteil tritt und sich mir gegenüber setzt. Das Gespräch über meinen ersten Auftrag wird mich vom quälenden Gedankenkarussell ablenken, das mich sowieso wachhalten würde. Sein Gesicht wirkt etwas knittrig, aber längst nicht so von Erschöpfung gezeichnet wie meines. Hoffentlich liegt es an seiner Erfahrung, dass der Auftrag ihn weniger mitnimmt als mich, und es fällt mir in Zukunft ebenfalls leichter.
»Ihr erster Auftrag, Margo«, leitet er unzeremoniell ein. »Was sagen Sie?« Er lächelt mich an, ganz der Alte.
Ich versuche, sein Lächeln zu erwidern, aber meine Mundwinkel zucken dabei. »Ich konnte sehr viel lernen und möchte Ihnen von ganzem Herzen danken, dass Sie mir das ermöglicht haben. Aber ich möchte Sie nicht langweilen mit den Worten einer unerfahrenen Reporterin. Wichtig ist, was Sie denken. Von meiner Arbeit.« Ich rutsche auf der Sitzfläche nach vorn.
»Eine Dokumentation wie viele andere. Nichts Außergewöhnliches. Doch mich interessiert, was Sie zu sagen haben. Ein wenig frischer Wind, wenn man so will.« Herr Dvorak lehnt sich vor, bis sein Kinn in seinen Händen ruht. Er mustert mich eingehend, bis ich zu Boden schaue und ergeben seufze.
»Ich hoffe wirklich, dass ich Ihrer Reportage nicht zu sehr im Weg stand. Vielleicht können Sie sogar ein oder zwei meiner Aufnahmen gebrauchen. Auch auf die Gefahr hin, anmaßend zu klingen – ich glaube, den Sonnenuntergang konnte ich einigermaßen adäquat einfangen. Hoffentlich.«
Er seufzt, kein gutes Zeichen. »Falls es Ihnen – unverständlicherweise – wirklich so große Sorgen bereitet, wie ich Ihre Arbeit einschätze … sie war tadellos. Viele der Aufnahmen sogar besser, als ich erwartet habe. Aber ich weiß, was Sie abliefern. Ich will wissen, wie Ihnen der Auftrag gefallen hat.«
Ich verstehe nicht, warum meine Bewertung für ihn so wichtig ist. Aber ich stelle seine Autorität sicher nicht in Frage. »Es war anstrengend – aber erfüllend. Ich erfreue mich daran, die Wahrheit für das Kollektiv darzustellen.« Ich halte meine Antwort für angemessen.
Sie passt ins Protokoll, doch Herr Dvorak legt die Stirn in Falten. »Ein wenig zu sehr aus dem Textbuch, Margo. Wenn ich Ihre Aufnahmen nicht schon hunderte Male gesehen hätte, würde ich Sie für leidenschaftslos halten.«
Ich will Einspruch erheben, ihm sagen, wie sehr ich meine Arbeit liebe. Nichts liegt mir ferner, als unengagiert zu erscheinen, doch er hebt die Hand. Mein Mund klappt wieder zu.
»Sie bemühen sich zu sehr, perfekt zu sein. Sagen Sie mir eine Sache, die Sie gestört hat. Eine Sache nur. Dafür wird Sie niemand einsperren.«
Viele Bilder surren durch mein Gehirn. Das Labor, der alte Mann auf dem Feld, das echte Gemälde in meiner Unterkunft. Immer wieder der alte Inferior, wie er zusammenbricht. Ich fische nach der Erinnerung, die am wenigsten kompromittierend ist. »Ich war überrascht von meiner Unterkunft.« Es ist raus. Gespannt halte ich die Luft an.
»Ihre Unterkunft?« Seine Augenbrauen schießen nach oben. »Was stimmte nicht mit Ihrer Unterkunft?«
»Nein, nein, an der Unterkunft war nichts auszusetzen, im Gegenteil.« Beschwichtigend wedle ich mit den Händen. »Aber das Bett, das Ölgemälde. Und das Auto, Herr Dvorak. Ich bin noch nie in einem Auto gefahren.«
Er hört mir so aufmerksam zu, dass ich mir sicher bin, nun doch ein paar Antworten zu bekommen. Wieso der ganze Luxus, wieso es niemanden verwunderte, jeden Tag mit einem Auto zur Bahnstation gefahren zu werden.
»Und das finden Sie schlecht?« Er neigt seinen Kopf in die andere Richtung, sodass seine Augen im Halbschatten wie schwarze Knöpfe scheinen. »Ein bequemes Bett, ein Bild und ein Auto?«
Er ist sauer. Ganz offensichtlich weiß ich nicht zu würdigen, was ich dank des Kollektivs bekommen habe. »Nein, nicht schlecht«, entschärfe ich prompt, »es hat mich nur überrascht. Ich denke, ich werde mich erst an die Utensilien, die Fahrzeuge und all das gewöhnen müssen. Natürlich können wir in der Weitläufigkeit des Quartiers nicht alles zu Fuß ablaufen. Wir müssen unsere Arbeit erledigen, so effizient wie möglich. Ich … Bitte verzeihen Sie mir. Meine Ausdrucksweise klang wirklich unmöglich.«
Herr Dvorak nickt jetzt, was mir die Spannung aus dem Rücken nimmt. Mir hätte klar sein müssen, dass seine Frage rhetorischer Natur war. Eine Höflichkeitsfloskel. Keine Aufforderung, tatsächlich etwas zu kritisieren.
Denn es gibt nichts zu kritisieren. Alles, was ich erlebt habe, hatte seinen Grund.
***
Endlich wieder zu Hause. Nun, eigentlich laufen wir direkt nach unserer Ankunft im Gewölbe zur Redaktion. Aber sie fühlt sich mehr wie mein Zuhause an, als meine neue Wohnung im Medienhexagon. Sogar mehr als das Apartment meiner Eltern, das ich seit Wochen nicht gesehen habe. In der Redaktion, zwischen Bildschirmen und Schneidetischen, fühle ich mich wohl. Zwar setzen wir uns in den kargen Konferenzraum, der mir mit den viel zu grellen Lampen am wenigsten lieb von allen Räumen ist, aber ich bin immerhin sicher.
Herr Dvorak gibt das Wort an Shanti weiter, seine rechte Hand. Seit einigen Wochen erhält sie eine Fortbildung als Schauspielerin. Kein Wunder. Wenn sie aufsteht, wallt ihr schwarzes Haar wie Seide über ihre Schultern. Ihr Blick schweift durch die Runde, bevor sie spricht. »Willkommen zur heutigen Besprechung«, leitet sie ein. Immer ein Lächeln auf den Lippen. Natürlich ist sie die perfekte Superior. Nicht nur engagiert und immer auf das Wohl der Gesellschaft bedacht, sondern auch optisch das absolute Idealbild einer Superior. Noch höher gewachsen als Herr Dvorak, mit langen, drahtigen Armen und Beinen, ein starker Rücken. Hübsch, aber nicht zu hübsch, sportlich, kerngesund. Niemand würde sie je verdächtigen, keine Superior zu sein. Und jeder unverheiratete Mann im Raum hängt an ihren Lippen. Es ist nicht, dass ich mir wünsche, so begehrt wie sie zu sein. Romantik und Beziehungen passen nicht zu meinem Leben, zu mir, zu meiner falschen Kraft. Ich könnte niemals mit jemandem zusammen sein und ihn gleichzeitig anlügen. Ich kann aber auch niemals jemandem die Wahrheit sagen. Niemals. So viel haben mir meine Eltern beigebracht. Aber manchmal wünscht sich ein winziger Teil in mir, dass sich zumindest irgendjemand für mich interessieren würde.
Sobald ich merke, wie ich abermals in Selbstmitleid versinke, richte ich mich rasch in meinem Stuhl auf. Seit dem Auftrag geschieht das ständig. So oft wie seit meiner Jugend nicht mehr, während der ich Vater wöchentlich darum bat, mich einfach nur zu den Inferior in das Quartier zu schicken. Ich dachte, dort könne ich meine Normalität besser verstecken. Wie ich mich getäuscht habe. Zwischen den schmächtigen Inferior mit eingefallenen Wangenknochen und ihren Anfällen – nein, meine Gedanken dürfen nicht dahin abschweifen – wäre ich aufgefallen wie jemand, der während des Ausgangsverbots auf den Straßen herumläuft. Es kommt vor, dass ein Superior kleiner oder dicker oder blasser ist. Aber ein gesunder, nicht verstrahlter Inferior würde man bei den regelmäßigen Gesundheitschecks sofort bemerken.
Ein Projektor erwacht surrend zum Leben, als Shanti einen Knopf auf ihrem Tablet antippt. Hinter ihr laufen Ausschnitte unseres Filmmaterials auf einer Leinwand. »Hier seht ihr das Material der Dokumentation. Herr Dvorak hat sie höchstpersönlich mit unserer neuen Kollegin Margo aufgenommen.«
Ich rutsche tiefer in den Sitz. Alle sehen meine Aufnahmen, was gleichzeitig peinlich und befriedigend ist. Endlich kann ich anderen zeigen, was ich sehe.
»Wie ihr merkt, haben wir viel zu tun. Eine Menge Videos, die wir optimal nutzen müssen. Amaniel, Derek, ihr kümmert euch um die Rohbearbeitung sämtlicher Clips. Und damit meine ich wirklich alle Clips, ihr lasst nichts aus.«
Gemurmelte Zustimmung, die Shanti nicht davon abhält, weiterzureden. »Wir wollen ein friedvolles Image fördern. Zeigen, wie gut es den Inferior im Verteilungswerk geht. Was sie zum Kollektiv beitragen. Wenig Konzentration auf die technischen Aspekte.« Natürlich, sonst könnte jemand auf ähnliche Gedanken wegen der Pflanzenbestrahlung kommen, wie ich im Labor. Was ich dort nach Alois Erklärung akzeptiert habe, bereitet mir jetzt wieder Kopfzerbrechen. Shanti wechselt zu Nahaufnahmen der arbeitenden Inferior. »Unsere Zuschauer wollen Menschen sehen, Emotionen. Niemand interessiert sich dafür, wie die Maschinen funktionieren. Natürlich soll es nicht so wirken, als verheimlichten wir etwas. Ernie, du filterst die wichtigsten vierzig Sekunden Material über technische Hintergründe heraus.« Sie verteilt weiter Aufgaben und erklärt, worauf geachtet werden soll. Erst als sie uns entlässt, fällt mir auf, dass sie mir keine Aufgabe übertragen hat, nicht einmal das Besorgen von Nutzungsrechten für die Musik.
Ich kämpfe mich durch den Strom meiner Mitarbeiter zu Shanti und Herrn Dvorak durch. Meine schwitzigen Hände wische ich an meinem Rock ab, denn ich weiß, dass ich hier durch muss. »Shanti, ich glaube du hast vergessen, meine Aufgabe zu erwähnen.«
»Deine Aufgabe?« Shanti blickt auf mich herunter, als hätte ich in der Sprache der Alten Welt gesprochen. »Margo, Schätzchen, du bist die Assistenz des Herrn Intendanten. Du überwachst die anderen bei ihrer Arbeit und entscheidest über den Schnitt.«
»Was?« Wie eloquent.
»Das muss dir doch klar sein? Du hast vorzügliche Arbeit geleistet, wir sind uns alle einig, dass du größere Verantwortung übernehmen solltest.«
Ein Rauschen dröhnt durch meine Ohren. Aus den Augenwinkeln schaue ich zu Herrn Dvorak hinüber, in der Erwartung, dass es ein Scherz ist oder Shanti sich vertan hat.
Aber er nickt nur zustimmend. Dann leuchten seine Augen auf, als erinnere er sich an etwas. »Gebt euch alle Mühe, so schnell wie möglich fertig zu werden. Und vergesst die anderen Projekte nicht, diese Woche soll viel rausgehen, damit die Leute nicht über das verschwundene Mädchen tratschen.«
Bevor ich nachhaken kann, runzelt Shanti die Stirn und kommt mir zuvor. »Verschwundenes Mädchen?«
Herr Dvorak seufzt tief. »Dass du noch nicht von ihr gehört hast, wundert mich. Aber umso besser, dann ist es doch noch nicht in aller Munde. Man sollte meinen, da wir kaum mit anderen Leuten außer unseren Kollegen zu tun haben, würden sich solche Geheimnisse nicht wie Radioaktivität verbreiten. Ein Fräulein Kara ist seit Tagen nicht bei der Arbeit erschienen. Angeblich zumindest. Du kennst solche Gerüchte. Natürlich weiß niemand Genaueres, niemand hat etwas gehört oder gesehen, aber trotzdem weiß schon das halbe Gewölbe Bescheid.«
»Kara? Melek Kara?«, frage ich. Bei dem Namen läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken.
»Sie kennen das Mädchen?« Herr Dvorak dreht sich mit einer hochgezogenen Augenbraue zu mir.
Ich muss schlucken. »Nur flüchtig. Wir waren früher in einer Klasse.« In Wahrheit ist Melek meine beste Freundin, auch heute noch, obwohl wir uns nur am Kinoabend sehen, seit wir in verschiedenen Hexagonen arbeiten. Ich arbeite im Medienhexagon als Journalistin, sie im Verwaltungshexagon als … ich weiß gar nicht genau, was sie tut. Ich weiß generell nicht viel über die Arbeit in den anderen Hexagonen, niemand tut das. Es ist nicht direkt gegen das Protokoll, die Filmvorstellung mit hexagonfremden Menschen zu besuchen, aber gern gesehen ist es auch nicht. Ich sollte den freien Abend nutzen, um eine engere Bindung zu meinen Arbeitskollegen aufzubauen. Allerdings hat mich Melek dazu gebracht, in diesem einen Punkt vom Protokoll abzuweichen.
»Soweit ich mich erinnern kann, heißt das Mädchen tatsächlich Melek.« Herr Dvorak tätschelt mir die Schulter, was schmerzt, und scheint genau zu erkennen, dass ich Melek nicht nur flüchtig kenne. »Aber vielleicht ist es eine andere Melek Kara?« Herr Dvorak verlässt mit Shanti an der Seite den Raum. Er will mir Mut machen, aber eine zweite Person mit dem gleichen Namen ist im Kollektiv unmöglich. Vor dem Atomkrieg gab es in jeder Stadt mehrere Menschen mit dem gleichen Namen. Aber nach dem Krieg schlossen die wenigen Überlebenden Frieden, müde des Krieges, des anhaltenden Hungers. Sie gründeten das Kollektiv, die letzte Stadt der Welt, als einen Ort der Zuflucht. Jeder war willkommen, egal, aus welchem Land, mit welcher Hautfarbe, ob gesund oder krank. Um die Menschen zu ehren, die trotz ihrer Unterschiede zusammenfanden, und gemeinsam ihre Vision aufbauten, tragen wir Namen aus allen ehemaligen Ländern. Die Obrigkeit achtet darauf, keine Namen doppelt zu vergeben, um die Vielfalt beizubehalten.
Doch unsere einzigartigen Namen bedeuten, dass es sich bei der angeblich verschwundenen Melek um meine Melek handelt. Ich verlasse den Konferenzraum lange nach allen anderen, ohne zu wissen, was genau ich in den vielen Minuten allein getan oder gedacht habe.
Während ich das Videomaterial im Gemeinschaftsbüro sichte, beruhige ich mich wieder. Menschen verschwinden im Kollektiv nicht einfach. Am Kinoabend in einigen Tagen werde ich Melek treffen. Wahrscheinlich wurde sie befördert und ihre alten Kollegen wissen nicht Bescheid. Da wir sonst kaum Gesprächsstoff haben, abgesehen von der Arbeit, wird über die ehemaligen Kollegen geredet, bis solche Gerüchte entstehen.
Genau das ist passiert, ich bin mir sicher. Sonst gäbe es nur eine andere Erklärung für ihr Verschwinden.
Und die ist unmöglich.
Willst du sofort erfahren, wenn es etwas Neues zu meinen Büchern gibt?
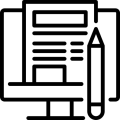
Rezensionsexemplare für Blogger, Youtuber & Co
Du kannst mich gern per Mail unter mail@lauracardea.de oder über das Kontaktformular anschreiben, wenn du Interesse an einem Rezensionsexemplar hast. Schick mir am besten direkt einen Link zu deinen Kanal (Blog, Youtube, Instagram, …) mit. Ich freue mich auf deine Anfrage! 🙂